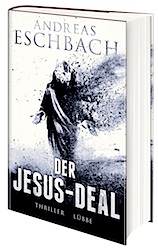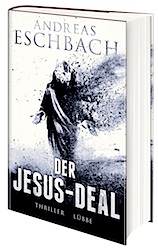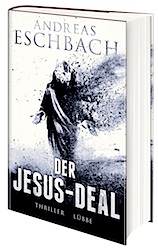
DER JESUS-DEAL
Roman
von
Andreas Eschbach
Fundstück 1
Im Jahr 1969 verhaftete das FBI einen Hilfskurator des State Museum in Harrisburg, Pennsylvania. Der 37-jährige Mann, dessen Name nur als Wassili R. überliefert ist, war aufgefallen, weil er immer wieder Ausstellungsstücke über Nacht mit nach Hause genommen hatte. Als die Beamten seine Wohnung durchsuchten, fanden sie dort zu ihrer Verblüffung ein Labor vor, das einzig dazu diente, Gegenstände auf das Vorhandensein von Osmium zu untersuchen, ohne sie zu beschädigen.
Die Verhaftung erfolgte am 22. Juli. Da am Tag zuvor amerikanische Astronauten zum ersten Mal auf dem Mond gelandet waren, schaffte es die entsprechende Pressenotiz nur in ein paar lokale Zeitungen.
Wassili R. wurde unter dem Vorwurf der Spionage für die Sowjetunion in Untersuchungshaft genommen. Es kam jedoch nie zu einem Prozess. Nach allem, was man weiß, ist Wassili R. im Jahr darauf gegen einen amerikanischen Agenten ausgetauscht worden.
Fundstück 2
Im Februar 1970 nahm die französische Polizei einen Mitarbeiter des Musée Historique de Haguenau fest, der sich, wie der Polizeisprecher in der Pressekonferenz erklärte, »auffällig benommen« habe: Er habe mehrfach Objekte aus dem Museum mit nach Hause genommen, angeblich, um sie zu reparieren, und dieses Verhalten auch nach ausdrücklichen Anweisungen, es zu unterlassen, fortgesetzt. Tatsächlich habe sich in der Wohnung des Mannes eine Werkstatt befunden, die allerdings einzig darauf ausgerichtet gewesen sei, festzustellen, ob die entliehenen Gegenstände das Element Osmium enthielten.
Der 40-jährige Mann, der erst seit Kurzem bei dem Museum angestellt gewesen war, hatte davor schon in mehreren anderen französischen Museen dasselbe eigentümliche Verhalten an den Tag gelegt. Das hatte aber jeweils nur zu seiner Kündigung geführt.
Auf die Frage eines Reporters, ob Osmium denn so wertvoll sei, erklärte der Commissaire, Osmium sei ein relativ seltenes Metall und demzufolge nicht gerade billig, dennoch sei es weit weniger wertvoll als Edelmetalle wie etwa Gold oder Platin, die in einigen der Exponate durchaus zu finden gewesen wären. Er fuhr fort: »Das Rätselhafte ist, dass Osmium erstmals im Jahr 1804 entdeckt worden ist; vorher war dieses Element völlig unbekannt. Von den Ausstellungsstücken, die der Verdächtige untersucht hat – und das gilt für alle Museen, in denen er angestellt war –, war jedoch keines jünger als zweihundertfünfzig Jahre.«
Der Mann, fügte er hinzu, werde psychiatrisch begutachtet. Man vermute, dass er an Wahnvorstellungen leide, könne aber noch nicht sagen, inwieweit ihn das gefährlich für die Allgemeinheit mache.
Fundstück 3
Am Sonntag, dem 2. Oktober 1994, verschwand den Berichten mehrerer schwedischer Zeitungen zufolge in der Nähe von Göteborg eine Frau unter rätselhaften Umständen und vor Zeugen spurlos aus einem Auto.
Liv B. und ihr Mann Sture waren an dem Tag bei ihren Eltern zu Gast gewesen. Es regnete unerwartet heftig, als sie gegen 14 Uhr aufbrechen wollten. Eine Weile stand die ganze Familie unschlüssig unter dem Vordach und wartete darauf, dass der Regen nachließ. Schließlich drängte Liv B. zum Aufbruch. Ihr Gatte spannte daraufhin seinen etwas zu kleinen Regenschirm auf, begleitete sie damit zum Wagen und hielt ihn über sie, während sie auf der Beifahrerseite einstieg. Ihr Bruder hat diesen Moment fotografiert: Auf dem Foto, das von mehreren Zeitungen veröffentlicht wurde, sieht man einen blonden Kopf hinter dem Wagendach eines roten Volvo und einen Mann, der einen Schirmgriff hält, ferner im Hintergrund dunkle Wolken, Regen und eine grüne, weitläufige Landschaft. Aufgenommen wurde es mit einer Kamera, die Datum und Uhrzeit in die Bilder einblendet; ihr zufolge war es in diesem Augenblick genau 14:05 Uhr.
Sture wartete, bis Liv die Tür zugezogen hatte, ging dann um den Wagen herum, winkte den Wartenden noch einmal zu, rief ein paar Worte zum Abschied und öffnete seinerseits die Tür auf der Fahrerseite. Nach übereinstimmender Meinung der Zeugen – den Eltern von Liv B. und ihrem Bruder – hatte das alles höchstens eine halbe Minute gedauert, eher weniger.
Doch als Sture B. in den Wagen stieg, war dieser zu seiner Verblüffung leer.
KAPITEL 1
Er wusste, dass die anderen ihn als Last betrachteten. Er war nur dabei, weil sein Vater, sein mächtiger Vater, darauf bestanden hatte, dass ein Barron an der Aktion teilnahm. Und wer sonst hätte das sein sollen als er, Isaak, der Erstgeborene und designierte Erbe?
Deshalb hatten die Männer ihn auf diesen Posten hier gestellt: um unter sich zu sein. Deshalb stand er sich seit zwei Stunden an der einzigen Bushaltestelle Barnfords die Beine in den Bauch und hielt Ausschau nach einem Auto, das einfach nicht kommen wollte. Er fror. Nur noch ein paar Tage bis Weihnachten: Das merkte man. Der Himmel war eine graue Suppe, aus den Schornsteinen stiegen dünne Rauchfäden empor, und es roch klamm, feucht, kalt.
Ein fernes Brummen, das ein sich näherndes Fahrzeug verriet. Etwa das zehnte oder zwölfte, seit er hier ausharrte, und wahrscheinlich würde es wieder einfach an der Ortschaft vorbeituckern. Trotzdem trat Isaak aus dem Schutz des hölzernen Wartehäuschens und reckte den Hals. Seine Aufgabe mochte überflüssig sein, er würde sie gleichwohl erfüllen, so gut er konnte.
Oh. Ein weißer Toyota. Isaak spürte sein Herz schlagen. Das stimmte schon mal. Zwei Personen darin. Auch das stimmte.
Er duckte sich zurück in den dunklen Unterstand, wartete, bis die Autonummer zu erkennen war. Tatsächlich. Die Nummer, die Whitewaters Leute aus Heathrow durchgegeben hatten.
Isaak zog das kleine Sprechfunkgerät aus der Tasche, drückte die Sprechtaste. »Posten eins«, sagte er leise. »Sie kommen.«
Der Toyota bremste ab, bog nach Barnford ein.
»Verstanden, Posten eins«, kam es krachend aus dem Funkgerät.
Isaak steckte es wieder weg, verfolgte aus der Deckung des Wartehäuschens, was weiter geschah. Das Auto parkte vor dem bewussten Haus. Die Insassen stiegen aus. Der Jüngere der beiden, der am Steuer gesessen hatte, eine Brille trug und sich auffallend gerade hielt, wohl um seine geringe Körpergröße wettzumachen, musste Stephen Foxx sein. Den Namen des Älteren, der sich eben in eine graugrüne Jacke und einen karierten Schal wickelte, hatte Mister Whitewater ebenfalls erwähnt, aber Isaak hatte ihn wieder vergessen.
Sie schauten sich um. Isaak zog sich noch weiter ins Dunkel zurück. Es sah nicht so aus, als ahnten sie etwas. Die beiden traten auf das bewusste Haus zu, lasen das Namensschild auf dem Briefkasten, öffneten das niedrige Gartentürchen, gingen zur Haustüre, klingelten. Ein weißhaariger Mann machte auf, wirkte überrascht – anders als Mister Whitewater und seine Leute hatte er tatsächlich nicht geahnt, dass die beiden kommen würden –, bat sie herein. Die Türe schloss sich wieder.
Er sah auf die Uhr, zog noch einmal das Funkgerät heraus. »Posten eins. Zehn Uhr sieben. Sie sind drin.«
»Verstanden, Posten eins. Dann komm jetzt zurück. Aber unauffällig.«
Na klar unauffällig. Hielten die ihn für blöd?
Wahrscheinlich.
Isaak steckte das Gerät ein und setzte sich in Bewegung. Er spielte den Spaziergänger, die Hände tief in den Manteltaschen vergraben, den Kopf eingezogen. Sah beim Überqueren der Straße erst nach rechts, dann nach links, wie es ihm sein Vater, Mister Whitewater und noch ein halbes Dutzend anderer Leute eingeschärft hatten. Weil sie in England waren, wo die Autos auf der falschen Straßenseite fuhren! Bloß war diese Vorsicht hier in Barnford überflüssig, denn sie befanden sich in einer der abgelegensten Gegenden Südenglands, mitten auf dem Land, und der Verkehr war äußerst überschaubar.
Während er die Straße entlangging, schaute er von den Häusern weg, als interessierten ihn die dunkelbraunen, frisch gepflügten Felder auf der anderen Seite viel mehr. Dann riskierte er aber doch einen Blick auf das Haus, in dem die beiden Männer verschwunden waren: ein kleines, altes Landhaus mit mächtigem Reetdach, halb versteckt hinter Büschen und Bäumen, umgeben von einem Garten, der sich offenbar selbst überlassen blieb, voller Unkraut und modrigem Laub.
Er achtete darauf, nicht langsamer zu werden, sich seine Neugier nicht anmerken zu lassen. Er bog um die Ecke. Da stand der graue Lieferwagen. War jemand zu sehen, der ihn beobachten konnte? Nein. Isaak klopfte kurz. Die Seitentür wurde aufgeschoben, und er stieg schnell ein.
Im Inneren des Wagens stank es nach Schweiß, Kaugummi und Ungeduld. Kein Wunder, die fünf Männer hockten seit heute Morgen hier drinnen, aßen nichts und tranken so wenig wie möglich, damit nicht ständig jemand zum Pinkeln hinaus musste. Das hätte auffallen können, und auffallen war genau das, was sie nicht wollten.
Mister Whitewater bedeutete Isaak, sich nach vorn auf den Beifahrersitz zu setzen, der einzige Platz, der frei war. »Kalt draußen, hmm?«, meinte er knurrig. »Ich hoffe nur, der Schnee wartet noch ein paar Stunden. Sonst kriegen wir Probleme.«
»Ja, Sir«, sagte Isaak, der wie so oft nicht recht wusste, was er auf solche Äußerungen sagen sollte. Eric Whitewater war ein enger Freund seines Vaters, ein massiger, kantiger Mann, der einen aus seinen eisgrauen Augen auf eine Art anblicken konnte, dass man sich fühlte wie ein Insekt unter der Lupe.
Einer seiner Leute, Bob, saß mit Kopfhörern am Empfänger der Abhöranlage, die sie irgendwann, irgendwie in dem Haus des Professors installiert hatten. »Klingt, als ob er endlich fertig ist mit seinem verdammten Tee«, verkündete er. »Sie gehen jetzt alle ins Wohnzimmer.« Er drehte an einem Regler. »Ich glaube, es geht schon los. Foxx knallt ihm seine Theorie an den Kopf.«
Whitewater streckte die Hand aus. »Lass mich mithören.«
Bob reichte ihm einen zweiten Kopfhörer. Whitewater setzte ihn auf, dann lauschten beide andächtig. Nach einer Weile sagte er: »Okay. Zeit, dass wir uns bereit machen. Tim, sag Wagen 2 Bescheid.«
Isaak wusste nicht, was in dem Haus vorging und worauf Whitewater und seine Männer warteten. Sein Vater hatte gesagt, das brauche er nicht zu wissen; es komme nur darauf an, dass er dabei sei. Was er wusste, war, dass ihre Aktion eine lange Vorgeschichte hatte. Dass Whitewater und seine Leute diesen jungen Mann, Stephen Foxx, monatelang abgehört und beobachtet hatten. Dass sie gewusst hatten, wann und mit welchem Flug die beiden Männer heute früh in London Heathrow landen würden. Dass in einem zweiten, weißen, kleineren Lieferwagen in der Parallelstraße noch einmal vier Männer auf ihren Einsatz warteten.
Und dass das alles dazu diente, gegen das siebte Gebot zu verstoßen. Sie waren gekommen, um etwas zu stehlen.
Alle Männer bis auf Bob standen auf, überprüften ihre Waffen, steckten sich die Ohrstöpsel der Funkgeräte in die Ohren. Sie waren alle schwarz gekleidet: schwarze Hosen, schwarze Rollkragenpullover. Aber was sie wirklich gefährlich wirken ließ, war das Funkeln in ihren Augen.
Whitewater holte kleine goldene Kreuze aus einer Schachtel und verteilte sie an die Männer.
»Damit sehen wir aus wie Pfarrer«, meinte einer grinsend, während er es sich umhängte. »Die werden denken, der Vatikan schickt uns.«
»Gut«, sagte Whitewater mit einem so kalten Ton in der Stimme, dass den Männern das Grinsen in den Gesichtern gefror. »Genau das sollen sie nämlich auch denken.«
»Und dann?«
Michael sah durchaus, dass sein großer Bruder todmüde war von dem Flug und allem. Aber er musste das jetzt wissen! Er saß auf Isaaks Bett, die Arme um die aufgestellten Beine geschlungen, weil ihm kalt war, und wartete ungeduldig darauf, dass es weiterging.
Isaak gähnte, dass sein Kiefer knackte, und spähte dann nach der Uhr auf seinem Nachttisch. »Halb vier! Sag mal, wieso bist du überhaupt wach?«
»Mom hat mir verraten, dass du heute Nacht zurückkommst«, erklärte Michael. »Also hab ich mir den Wecker gestellt und bin früh ins Bett, ganz einfach.« Isaak brauchte nicht zu glauben, dass er als Einziger cool war.
Obwohl Isaak schon ziemlich cool war. Es verschlug Michael manchmal regelrecht den Atem, wenn er darüber nachdachte. Was er sich natürlich auf keinen Fall anmerken lassen durfte. Isaak war vier Jahre älter als er, schon achtzehn und … nun, einfach vollkommen. Hatte in der Schule in den meisten Fächern beste Noten. War groß, stark und sportlich. War fromm und gottesfürchtig wie kaum jemand, den Michael kannte. Hatte in all seinen Dingen makellose Ordnung, vergaß nie zu beten, wusste alles, konnte alles, hatte keinerlei Schwächen und bot allen Versuchungen Satans unanfechtbar die Stirn. Die Mädchen an der Schule schwärmten alle für ihn. Isaak war auch zu allen freundlich, aber er ließ sich auf nichts ein, obwohl er wirklich nur mit den Fingern hätte schnippen müssen.
Dass er selber jemals so tugendhaft sein würde, daran hegte Michael schmerzhafte Zweifel. Allein, was ihm manchmal an sündigen Gedanken durch den Kopf ging, wenn er an Jennifer dachte, das neue Mädchens an der Schule, die lange, blonde Haare hatte, einen Zopf bis zum Hintern –
»Jetzt erzähl schon!«, drängte er seinen Bruder.
Isaak seufzte, richtete sich auf und hob ein Stück seiner Bettdecke an. »Deck dich wenigstens zu. Ich frier ja, wenn ich sehe, wie du da sitzt und bibberst.«
Michael schlüpfte bereitwillig unter die warme Decke, streckte die kalten Zehen aus, bis sie Isaaks Schenkel berührten. Isaak zuckte zusammen, aber er beschwerte sich nicht. Typisch Isaak. Sein Bruder hatte sich schon immer für andere eingesetzt, fast so, wie die Helden und Heiligen in den Geschichten es taten. Vor einiger Zeit zum Beispiel für seinen Kunstlehrer, Mister Lofelmaker, der aus Gründen, über die man nichts Näheres erfahren hatte, mitten im Schuljahr entlassen worden war. Isaak war in einer Versammlung zu diesem Thema aufgestanden und hatte vor dem Rektor, den Eltern und den anderen Lehrern erklärt, wie ungerecht er das fände. Und dabei war es ihm bestimmt nicht um seine Noten gegangen, denn die waren ausgerechnet bei Mister Lofelmaker nicht besonders gut gewesen!
»Also?« Michael stupste seinen Bruder mit seinen kalten Zehen. Das hatte Isaak nun davon! »Mister Whitewater hat seinen Männer goldene Kreuze gegeben, und dann?«
»Dann sind sie los. Zackig. Tür auf, raus, Tür zu, über die Straße zu dem Grundstück, mit einem Schritt über den Zaun und rein ins Gebüsch. Und im nächsten Moment waren sie so gut wie unsichtbar.« Isaak klang jetzt so angespannt, als erlebe er alles in der Erinnerung noch einmal. »Die drei Männer aus Wagen 2 hatten den Befehl, von hinten durch die Kellertür ins Haus einzudringen und sich bereitzuhalten, um auf das Signal hin sämtliche Fluchtwege abzuschneiden. Sie hatten Nachschlüssel, mit denen das völlig lautlos gehen würde. Bob hat mich angegrinst und mir auch einen Kopfhörer gegeben, damit ich mithören konnte. Man hat sie nur atmen hören. Plötzlich sagt Whitewater: Mist. Was ist, fragt Bob. Darauf Whitewater: Matthew ist auf einen Ast getreten, das hat die Vögel von den Bäumen aufgescheucht. Gib ans Team 2 weiter, sie sollen im Keller warten.«
Michael presste die Lippen zusammen, schlotterte ein bisschen an den Schultern. Musste an der Kälte liegen. Er rutschte ein Stück tiefer unter die Decke. »Und dann?«
»Eine Weile ist alles still«, fuhr Isaak fort. »Bob hat immer zwischen zwei Hörern hin und hergewechselt, auf dem einen hat er belauscht, was die drinnen im Wohnzimmer geredet haben, auf dem anderen waren die Männer. Okay, sagt er schließlich, ich glaube, die haben nichts gemerkt. Sie gehen grade rüber ins Arbeitszimmer. Foxx hat dem Professor ganz schön zugesetzt. Nur noch eine Frage von Minuten, bis er das Zielobjekt herausholt, würde ich sagen. Gut, sagt Whitewater, sobald er das tut, schlagen wir zu.« Isaak atmete geräuschvoll aus. »In dem Moment dreh ich mich um und seh, dass gerade ein großer Lastwagen in die Straße einbiegt.«
»Puh!«, entfuhr es Michael. »Was für ein Lastwagen?«
»Riesig, weiß, mit ’nem Firmenlogo drauf. Da kommt was, sage ich zu Bob. Der guckt hoch und sagt: Mist.« Isaak grinste. »Also, in Wirklichkeit hat er natürlich nicht Mist gesagt, sondern richtiggehend geflucht.«
»Klar«, sagte Michael. Wer hätte das nicht in so einer Situation? Ihm flatterte vom bloßen Zuhören die Bauchdecke.
»Eric, sagt er, da kommt gerade ein Möbeltransporter, ihr müsst einen Moment warten. Darauf hat Mister Whitewater geflucht und gesagt, es wird doch nicht jemand umziehen. Dann hat er gemeint, okay, wir warten, bis sich die Lage klärt. Ich beobachte den Lastwagen, wie er drei, vier Häuser vor uns hält. Zwei Männer steigen aus, lassen die Klappe runter. Der Wagen steht mit dem Führerhaus zu uns, sodass wir nicht reinschauen können. Eine Frau kommt aus dem Haus, graue Haare, rosa Kittelschürze. Gleich darauf sehen wir, sie laden eine Waschmaschine aus und karren sie ins Haus. Es scheint nur eine Waschmaschine zu sein, gibt Bob durch. Okay, sagt Whitewater, wir warten noch. Wir haben Zeit, die schauen sich das Ding gerade an.«
»Was für ein Ding?«
»Keine Ahnung. Jedenfalls, wir rühren uns nicht. Nach einer Weile kommt einer von den Männern raus, zum Rauchen. Steht rum, glotzt in die Luft, zieht die Schultern ein, weil er friert, geht wieder rein. Ich hab ständig die Uhr im Blick. Eine Viertelstunde, zwanzig Minuten. Dann kommen sie wieder zum Vorschein, eine andere, alte Waschmaschine auf der Trage, laden sie auf, steigen ein und fahren davon. Bob gibt durch, als sie außer Sicht sind, und Whitewater sagt sofort: Okay. Zugriff. Und im nächsten Moment klirrt es so laut, dass mir die Ohren wehtun.«
»Was ist passiert?«
»Sie haben zwei Glastüren zum Garten eingeschlagen und sind rein. Bob hört an der Abhöranlage mit, meint, super, genau der richtige Zeitpunkt. Sie haben alles unter Kontrolle, die drei leisten keinen Widerstand. Eric hat das Zielobjekt gesichert, nur der Junge mault ein bisschen rum, ansonsten alles unter Kontrolle. Dann sagt Bob: Okay, Abzug. Er verscheucht mich vom Beifahrersitz, meint, ich soll die Tür hinten aufmachen, setzt sich ans Steuer und lässt den Motor an. Whitewater und die anderen kommen angespurtet, springen auf, und los geht es. Wir haben vier verschiedene Fluchtwege vorbereitet, aber es verfolgt uns niemand, also bleiben wir beim ersten Plan. Wir biegen nach ein paar Meilen ab auf einen Feldweg in den Wald, auf eine Lichtung, wo der Hubschrauber steht. Wir alle rein bis auf zwei Männer, die zurückbleiben, um die beiden Autos fortzubringen und dann unterzutauchen. Der Hubschrauber hebt ab, bringt uns zu einem Flugplatz, wo ein Jet wartet, und ab geht es nach Hause.« Isaak, der zuletzt nahezu atemlos erzählt hatte, holte Luft. »Kommt mir ganz seltsam vor, dass es Nacht sein soll. Ich hab im Flugzeug geschlafen und bin jetzt irgendwie total durcheinander.«
Michael war ganz kribbelig, weil die brennendste Frage trotz allem unbeantwortet geblieben war. »Und was war das? Was war das für ein Ding, das ihr erbeutet habt?«
Sein großer Bruder schwieg in dem Dämmerlicht, das das Zimmer beherrschte.
»Ich weiß es nicht«, wisperte er schließlich kaum hörbar. »Dad hat gesagt, es sei der wichtigste Gegenstand der Welt. Sein oder Nichtsein hängt daran, hat er gesagt. Unser Seelenheil. Das Schicksal der gesamten Menschheit.«
|